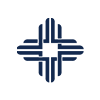Mit der neuerlichen Verschärfung der Klimaziele gewinnt die Diskussion um den Umbau zur klimaneutralen Stahlerzeugung an Konturen. Die Stahlerzeuger haben ihre Forderungen auf den Tisch gelegt, die Politik in Berlin scheint weitgehend folgen zu wollen. Der kürzlich vorgelegte „fit for 55“-Plan der EU erfüllt zwar nicht alle Wünsche. Aber auch in Brüssel wird die Stahlindustrie als schützenswerte Schlüsselbranche angesehen. Die Belange der europäischen Stahlverarbeiter kommen in der Diskussion erstaunlich wenig vor. Dabei kann die Transformation ohne Einbeziehung der Kunden nicht gelingen. Für wettbewerbsfähige Wertschöpfungsketten muss der Staatseinfluss begrenzt bleiben.
Forderungen der Stahlindustrie liegen auf dem Tisch

Folgt man den Positionspapieren der Stahlerzeuger und ihrer Verbände, so stellt sich die (hochofenbasierte) europäische Stahlindustrie den Weg zum grünen Stahl ungefähr so vor:
- Die weitgehend kostenfreie Zuteilung von Zertifikaten im Rahmen des europäischen Emissionshandels bleibt noch lange erhalten.
- Die nötigen Investitionen in den Anlagenpark der bestehenden Stahlstandorte werden mit Hilfe eines noch zu schaffenden „Transformationsfonds“ großzügig aus öffentlichen Mitteln finanziert, ebenso der Aufbau der benötigten Wasserstoff-Infrastruktur. Europäische Beihilferegeln werden dafür entsprechend aufgeweicht.
- Zusätzlich werden Importe mit Hilfe einer aggressiven Anwendung von Handelsschutzinstrumenten und einem CO2-Grenzausgleich so verteuert, dass sie kaum noch Alternativen bieten.
- Europäische Verarbeiter werden durch verbindliche Quoten und europäische Standards verpflichtet, den in Europa hergestellten Stahl zu kaufen.
Damit soll bis 2050 nicht nur eine große CO2-Reduktion erreicht werden, sondern auch die Stahlindustrie durch einen neuen technologischen Vorsprung an internationaler Wettbewerbsfähigkeit gewinnen.
Offene Ohren der Politik
Vielleicht auch wegen des aufziehenden Bundestagswahlkampfes stoßen diese Forderungen in der nationalen Politik parteiübergreifend auf offene Ohren. Stahlwerksbesuche mit Fototermin und Solidaritätsbekundungen gehören zum guten Ton. Besonders Bundeswirtschaftsminister Altmaier tut sich mit Treueschwüren zur Stahlindustrie hervor. Die nötigen Gesamtinvestitionen für den Umbau zur CO2-freien Stahlproduktion in Deutschland, die der Minister jüngst auf insgesamt 35 Milliarden Euro bezifferte, könnten in den kommenden 30 Jahren mit etwa 10 bis 12 Milliarden Euro aus öffentlichen Hilfen gefördert werden. Den Anfang macht eine Förderung in Höhe von ca. 2 Mrd. €, die deutsche Stahlhersteller im Rahmen der staatlichen Förderung für Wasserstoffgroßprojekte, der sogenannten Wasserstoff-IPCEI, erhalten. Weitere 2,9 Mrd. € sollen alleine bis 2024 an die Stahlindustrie im Rahmen des noch kommenden Förderprogramms „Dekarbonisierung in der Industrie“ gezahlt werden. Hoch im Kurs stehen in der Politik auch sog. Klimaschutzverträge („carbon contracts for differences“), mit denen Mehrkosten einer klimafreundlichen Produktion ausgeglichen werden sollen. Hier sind Pilotprojekte in der Stahlindustrie geplant. Trotz der zahlreichen Maßnahmen verhehlt mancher Stahlerzeuger nicht, dass er noch großzügigere Hilfen erwartet.

Die EU hat mit ihrem neu vorgestellten „fit for 55“-Plan ihr Programm für den Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft vorgelegt. Enthalten ist der Vorschlag, ab 2023 einen CO2-Grenzausgleich für Stahleinfuhren einzuführen, der ab 2026 kostenwirksam sein soll. Zum Leidwesen der Stahlindustrie, aber aus ökologischen und politischen Gründen wohl alternativlos, soll gleichzeitig die kostenfreie Zuteilung der Verschmutzungszertifikate im Rahmen des EU-Emissionshandel schrittweise zurückgefahren werden. Trotzdem gilt auch in Brüssel die Stahlerzeugung als Schlüsselindustrie, die es besonders zu schützen und mit öffentlichen Geldern zu unterstützen gilt.
Die Diskussion, ob der EU-Alleingang mit immer höheren CO2-Minderungszielen in immer kürzeren Zeiträumen sinnvoll ist und am Ende wirklich dem Welt-Klima hilft, wird kaum noch geführt. Der Zug ist auf die Schiene gesetzt und wird weiterfahren. Für die Politik ist die Stahlindustrie gut als Symbol dafür geeignet, dass der Klima-Umbau wirtschaftsverträglich gelingen kann. Suggeriert wird, bestehende Strukturen bis hin zum einzelnen Stahlwerk ließen sich 1:1 in die neue kohlenstofffreie Zeit übertragen. Mit einer großzügigen Unterstützung aus Steuergeldern lassen sich Konzern- und Gewerkschaftschefs gleichermaßen befrieden. Nebenbei soll für die als zentral angesehene Wasserstoffwirtschaft ein stabiler Abnahmegarant geschaffen werden.
Transformation muss vom Ende her gedacht werden
Die Folgen des anstehenden Umbaus für die hiesigen Wertschöpfungsketten sind in der Diskussion erstaunlich wenig präsent. Industrielle Abnehmer wie Endkunden kommen eher als Parteien vor, die zu ihrem Glück gezwungen werden müssen. Im besten Fall wird vorgerechnet, dass grüner Stahl zwar viel teurer sei als konventionell erzeugter. Dies müsse aber zugunsten des Klimas in Kauf genommen werden und mache bei einem Auto sowieso nur ein paar Hundert Euro aus. Wo genau die zu erwartenden Mehrkosten entlang der Wertschöpfungskette getragen werden sollen, wird schon nicht mehr diskutiert. Dass zahlreiche mittelgroße Zulieferer zerrieben werden könnten zwischen den Herstellern und großen Kunden, die zwar grünen Stahl wollen, deren Zahlungsbereitschaft aber unklar ist – dazu findet sich in den Verlautbarungen wenig bis nichts. Ob der durch grünen Stahl zu erwartende Kostenschub für Verarbeiter mit speziellen Hilfsmaßnahmen abgemildert werden soll oder inwiefern Hersteller die Staatsgelder zum Vorteil ihrer Kunden weitergeben sollen, ist unklar.
Richtigerweise weisen Politiker darauf hin, dass die Stahlerzeugung als Basis von komplexen industriellen Wertschöpfungsketten in der EU unverzichtbar ist. Umgekehrt gilt aber auch: ohne international wettbewerbsfähige Verwenderindustrien hat die hiesige Stahlindustrie keine Zukunft. Stahlverarbeiter wie die Automobilindustrie und ihre Zulieferer oder der Maschinenbau haben etwas, was die hiesige Stahlindustrie schon lange verloren hat: eine starke Position auf globalen Wachstumsmärkten vor allen in Asien. Große Mengen des hier hergestellten Stahls werden nach der Verarbeitung exportiert („indirekter Stahlexport“). Studien kommen zu dem Ergebnis, dass in Deutschland ca. 40% mehr Stahl verarbeitet als im Inland verbraucht wird.
Transformationskonzepte, die ein mögliches „carbon leakage“ in der Stahlverarbeitung nicht bedenken, führen zu einer Erosion des Kundenstamms der europäischen Stahlindustrie und zu einem Verlust von vielen industriellen Arbeitsplätzen. Letzten Endes ist gerade in Deutschland der industrielle Mittelstand in seiner Grundstruktur bedroht. Dies wird sträflich unterschätzt. Erfahrungen deutscher energieintensiver Stahlverarbeiter mit zusätzlichen Kosten aus dem nationalen Emissionshandel unterstreichen dies und könnten nur ein Vorgeschmack auf das sein, was noch kommt.
Zukunftslösungen müssen sich im Wettbewerb behaupten

Neben vielen anderen Faktoren ist eine sichere Versorgung mit Stahl in bester Qualität zu international wettbewerbsfähigen Preisen ein wichtiges Kriterium für Standortentscheidungen von Verarbeitern und für Vergabeentscheidungen von Endkunden, die sich im internationalen Wettbewerb behaupten müssen. Der Versuch, eine überwiegend mit Steuergeldern transformierte EU-Stahlindustrie vor globaler Konkurrenz abzuschotten und die Verarbeiter mit erheblichen Mehrkosten alleine zu lassen, wird nicht zum Erfolg führen. Gerade weil in vielen Branchen die Wachstumsregionen nicht in Europa liegen und Standortentscheidungen global getroffen werden, ist das Risiko von weiteren Produktionsverlagerungen groß. Die Tatsache, dass die Automobilproduktion deutscher Hersteller seit Jahren nur noch im Ausland wächst, spricht für sich. Zulieferer, die den Markt heute häufig noch von Deutschland aus bedienen, werden folgen, wenn sich die Standortbedingungen weiter verschlechtern.
Stahlverwender können nur bis zu einer gewissen Grenze zum Einsatz von europäischem Stahl gezwungen werden. Sie müssen davon überzeugt werden. Und wenn sie den CO2-Abdruck des eingesetzten Stahls verringern wollen, werden sie dafür die im internationalen Vergleich beste Lösung wählen. Das Bild, dass die EU den Umbau massiv vorantreibt, während der Rest der Welt schläft, ist falsch. Mögen auch die jeweiligen Rahmenbedingungen, Minderungsziele und Zeithorizonte unterschiedlich sein – überall stellen sich Stahlhersteller der Aufgabe des Umbaus. Während Nordamerika von einem hohen Produktionsanteil der deutlich weniger klimaschädlichen Elektrostahlwerke profitieren will, werden in Asien vielfach Bündnisse zwischen großen Eisenerzkonzernen und Stahlherstellern geschmiedet. Beträchtliche Investitionen sind bereits angekündigt. Zudem zeichnet sich ein Trend zur Konsolidierung und zu neuen Bündnissen auch über Wertschöpfungsgrenzen hinweg ab. Auch in China ist das Thema auf der politischen Agenda weit nach oben gerückt.
Am Markt ist gleichzeitig zu beobachten, dass Stahlverwender sich ihre eigenen Gedanken darüber machen, auf welchem Weg sie ihren „scope 3“- CO2-Fußabdruck am besten verringern. Sie wollen den Wandel aktiv gestalten. Unternehmen etwa aus der Automobil- oder Konsumgüterindustrie verfolgen ihre eigenen Klimaziele und fordern von ihren Zulieferern schon heute Zusagen über eine deutliche Verringerung des CO2-Ausstoßes bei den eingesetzten Stählen. Gleicht man diese Forderungen mit den veröffentlichten Minderungszielen vieler Stahlhersteller für den Zeitraum bis 2030 ab, bekommt man den Eindruck, dass sich in den kommenden Jahren eher ein Mangel an „grünem“ Stahl einstellen wird als dass dessen Einsatz mit Zwangsquoten vorangetrieben werden müsste.
Öffentliche Förderung muss begrenzt bleiben

Damit werden die Kriterien „Effizienz“ und „Zeit“ über den Erfolg von Dekarbonisierungsstrategien entscheiden. Zwar ist eine öffentliche Förderung der Stahlhersteller angesichts der Größe der Herausforderung vertretbar. Die Erfolgschancen europäischer Erzeuger sind aber umso größer, je mehr die Lösungen der Zukunft unter einem hohen Einsatz eigener Mittel und ohne Abschottung vor Wettbewerb gefunden werden. Unter diesem Gesichtspunkt sollte die öffentliche Förderung der Stahlhersteller in der Höhe begrenzt und auf EU-Ebene koordiniert werden. Es macht wenig Sinn, vergleichbare Technologien mehrfach und an jedem bestehenden Standort zu fördern. Denn nicht jeder der heute großen Stahlstandorte bringt unbedingt die optimalen Bedingungen für den Betrieb von „grünen“ Erzeugungsanlagen mit. Dennoch ist schon jetzt in der EU der Beginn eines nationalen Subventionswettlaufs zu beobachten, der an unselige frühere Zeiten erinnert.
Die Umstellung auf neue Produktionsverfahren sollte zu mindestens 50% aus Eigenmitteln der Hersteller oder mit privatem Fremdkapital finanziert werden. Zu bedenken ist dabei, dass die europäischen Hochöfen im internationalen Vergleich am ältesten sind und zahlreiche Aggregate ohnehin vor der Erneuerung stehen. Ebenso sind die häufig als Zwischenstufe geplanten gasbefeuerten Direktreduktionsanlagen keine neue Technologie mehr.
Wegweisend für private Lösungen mit hohen Zukunftschancen ist der im Rahmen des H2Green Steel-Projekts angekündigte Neubau eines „grünen“ Stahlwerks in Nordschweden, der bei aktivem Mitteleinsatz späterer Kunden privat finanziert und bereits 2024 in Betrieb gehen soll. Die Initiative zeigt, dass Kunden und private Investoren von guten Lösungen überzeugt werden können.
Ob die durch chronische Ertragsschwäche gekennzeichnete Branche die für eine Umstellung nötigen Eigenmittel überhaupt aufbringen kann, soll an dieser Stelle offenbleiben. Wäre dies nicht der Fall, wäre der direkte Einstieg des Staates die ehrlichere, wenn auch keine gute Lösung.
Zu den Autoren: Andreas Schneider ist Inhaber von StahlmarktConsult Andreas Schneider, Martin Kunkel ist Geschäftsführer der Fachvereinigung Kaltwalzwerke e.V.
Foto: StahlmarktConsult, Fachvereinigung Kaltwalzwerke und Fotolia
Der Gastkommentar spiegelt die Meinung des Autors wider, nicht notwendigerweise die der Redaktion von marketSTEEL.
03.08.2021 von unsem Gastkommentator